Stand: 08.12.2025
Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir verantwortungsvoll mit Ihren personenbezogenen Daten umgehen. Sofern wir personenbezogene Daten von Ihnen erheben, verarbeiten wir diese unter Beachtung der geltenden Datenschutzvorschriften. Detaillierte Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Einwilligung in die Verwendung von Daten zu Werbezwecken
Ich bin damit einverstanden, dass die Vogel IT-Medien GmbH, Max-Josef-Metzger-Straße 21, 86157 Augsburg, einschließlich aller mit ihr im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen (im weiteren: Vogel Communications Group) meine E-Mail-Adresse für die Zusendung von Newslettern und Werbung nutzt. Auflistungen der jeweils zugehörigen Unternehmen können hier abgerufen werden.
Der Newsletterinhalt erstreckt sich dabei auf Produkte und Dienstleistungen aller zuvor genannten Unternehmen, darunter beispielsweise Fachzeitschriften und Fachbücher, Veranstaltungen und Messen sowie veranstaltungsbezogene Produkte und Dienstleistungen, Print- und Digital-Mediaangebote und Services wie weitere (redaktionelle) Newsletter, Gewinnspiele, Lead-Kampagnen, Marktforschung im Online- und Offline-Bereich, fachspezifische Webportale und E-Learning-Angebote. Wenn auch meine persönliche Telefonnummer erhoben wurde, darf diese für die Unterbreitung von Angeboten der vorgenannten Produkte und Dienstleistungen der vorgenannten Unternehmen und Marktforschung genutzt werden.
Meine Einwilligung umfasst zudem die Verarbeitung meiner E-Mail-Adresse und Telefonnummer für den Datenabgleich zu Marketingzwecken mit ausgewählten Werbepartnern wie z.B. LinkedIN, Google und Meta. Hierfür darf die Vogel Communications Group die genannten Daten gehasht an Werbepartner übermitteln, die diese Daten dann nutzen, um feststellen zu können, ob ich ebenfalls Mitglied auf den besagten Werbepartnerportalen bin. Die Vogel Communications Group nutzt diese Funktion zu Zwecken des Retargeting (Upselling, Crossselling und Kundenbindung), der Generierung von sog. Lookalike Audiences zur Neukundengewinnung und als Ausschlussgrundlage für laufende Werbekampagnen. Weitere Informationen kann ich dem Abschnitt „Datenabgleich zu Marketingzwecken“ in der Datenschutzerklärung entnehmen.
Falls ich im Internet auf Portalen der Vogel Communications Group einschließlich deren mit ihr im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen geschützte Inhalte abrufe, muss ich mich mit weiteren Daten für den Zugang zu diesen Inhalten registrieren. Im Gegenzug für diesen gebührenlosen Zugang zu redaktionellen Inhalten dürfen meine Daten im Sinne dieser Einwilligung für die hier genannten Zwecke verwendet werden. Dies gilt nicht für den Datenabgleich zu Marketingzwecken.
Recht auf Widerruf
Mir ist bewusst, dass ich diese Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen kann. Durch meinen Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund meiner Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Um meinen Widerruf zu erklären, kann ich als eine Möglichkeit das unter https://contact.vogel.de abrufbare Kontaktformular nutzen. Sofern ich einzelne von mir abonnierte Newsletter nicht mehr erhalten möchte, kann ich darüber hinaus auch den am Ende eines Newsletters eingebundenen Abmeldelink anklicken. Weitere Informationen zu meinem Widerrufsrecht und dessen Ausübung sowie zu den Folgen meines Widerrufs finde ich in der Datenschutzerklärung.



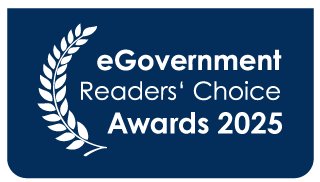
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/98/87/988732bee4abe6b030e7bf5032466063/0129321130v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/d7/09/d709274b4d04d731d9eeff36717a7481/0129059328v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/a6/14/a6144da5d2add93ce08bf89eb83f768f/0129185103v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/d0/64/d06462771f7723c7b1142d6edf71947e/0129303818v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/db/21/db212fe29bdc3f7282eef666d310c607/0129318820v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/96/f9/96f97508883e030cac8f2a3827040b3d/0129108367v3.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/49/be/49bece5be9ab23d2562a68946cbf2829/0129124933v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/a8/c9/a8c959f32cc4ebba6cf1531d77785a4b/0129094039v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/80/5b/805b612af7de02ab07b2a1a397440f3b/0128166269v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/5f/8f/5f8faad4afec8fe9e707f4dcf66f2241/0128310661v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/26/4e/264eb24d3d8fb6970634864f5caa0c9a/0128145508v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/60/d5/60d512f641b780e22bf926fa7b7e9662/0129092381v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/71/ae/71aeab856e1def738378eb2203cf1a03/0129192734v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/e3/df/e3df2d6cab8d3fea553fa397b6d73d8a/0129271243v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/47/cf/47cf85cb05c20ffc5f8bdb06e18f96f1/0128870274v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/a4/ed/a4edd26c3f9be221cda55c459182f3e2/0129236742v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/18/96/1896e3a6ff5662cb8cc3916e70eaaca1/0128771682v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/4d/e4/4de4451360df23707ec5a930ce162b95/0128444441v6.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/9a/dd/9adda3170a0349cdecf8355ecb1b5f3d/0124723437v3.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/a5/77/a57764d9ab42cddc9ce74c79f8afbff5/0124379835v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/82/1f/821f31598dfc3f1aca3ead28fcf3529b/0123901076v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/d2/38/d238b9e6c5bec4995cff976c5a00870e/0127069863v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/f4/28/f42807d575943540de71f909fa871105/0125662510v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/71/80/7180526003a0e18ec27f4ea35b590a74/0125015548v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/0a/4a/0a4a09b1d8a5e718a0f9357810b613ee/0125273923v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/11/a4/11a4262cb4795d3c5c4f8b494db16798/0125243090v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/b6/69/b669d70fd07e52da911b10385ef06f11/0122476909v1.jpeg)
:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/62/8c/628cba8e3f912/logo-governikus-600px.png)
:fill(fff,0)/images.vogel.de/vogelonline/companyimg/102000/102099/65.jpg)
:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/69/79/6979e6b6642ed/tqg-logo-rgb-blau.png)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/05/ae/05ae9a1d6e43331017442c1a6a3a3803/0127818491v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/00/bd/00bdcf35a53863a378f548639e31290b/0128158164v1.jpeg)