Anbieter zum Thema
Das Verbot unlauteren Wettbewerbs
7. In vergaberechtlicher Hinsicht sind – je nach Vertriebsmodell – die Grenzen zulässiger Inhouse-Vergabe oder die formalen Ausschreibungsbedingungen zu klären. Vor allem muss eine Diskriminierung kleinerer oder mittlerer Unternehmen vermieden werden. Die IT-Beschaffung des Staates ist nach den Grundsätzen zu den Leistungsbeschreibungen im Vergaberecht produktneutral, das heißt, hersteller-, lieferanten- und vertriebsneutral zu halten.
Etwas anderes kann nur dann gelten, wenn für bestimmte Technologievorgaben ein sachlich begründeter Bedarf besteht, der nur und gerade durch die vorgenommenen Spezifikationen zu erfüllen ist. Sachliche Gründe sind vor allem solche Argumente, die mit Nutzbarkeit und Wirtschaftlichkeit der Produkte in engem Zusammenhang stehen. Dazu zählen insbesondere die Interoperabilität der IT-Produkte, die gesteigerten Anforderungen des elektronischen Verwaltungsverfahrens an die IT-Sicherheit, die übergreifenden Anpassungs- und Wartungsmöglichkeiten, sowie die Nachhaltigkeit der Produkt- und Systementscheidung für die öffentliche Verwaltung, zuweilen auch über die Grenzen der Kommunen oder des Bundeslandes hinaus.
8. In wettbewerbsrechtlicher Hinsicht besteht zwar kein Schutz vor konkurrierender „Behördensoftware“. Der Staat ist aber – soweit kein zulässiges Verwaltungsmonopol errichtet wird – zu lauterem Verhalten gegenüber privaten Marktteilnehmern verpflichtet. Dazu zählt zum Beispiel Transparenz der Angebotssituation und die Unterlassung irreführender Informationen an die Kunden. Aus dem Verbot unlauteren Wettbewerbs in Verbindung mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz folgt auch die Pflicht des Staates, alle Marktteilnehmer (also nicht nur einen etwaigen privaten Projektpartner) zeitgleich und in gleichem Umfang mit solchen (zum Beispiel Schnittstellen-) Informationen zu versorgen, die für den sachgemäßen Einsatz der eGovernment-Fachanwendung erforderlich sind.
Unzulässig wäre es auch, die staatliche Machtstellung ausschließlich zur Arbeitsplatzsicherung eigener Behördenbeschäftigter zu nutzen und einen existierenden privaten Anbietermarkt für IT-Systeme aus dem Markt zu drängen.
9. Der Staat hat eine Marktverantwortung für die Balance zwischen Sicherheit und Wettbewerb. Stärker als in anderen Wirtschaftsbereichen besteht im Prozess der Digitalisierung sowohl die Notwendigkeit politischer Führung als auch die Notwendigkeit unternehmerischer Freiheit. Dem wird die öffentliche Hand in ihrem Marktverhalten bislang zu wenig gerecht. Zwar gibt es normative Ansätze wie die Etablierung eines IT-Planungsrates durch Art. 91c GG und den IT-Staatsvertrag. In der Praxis entspricht dieser jedoch nicht den in ihn gesetzten Erwartungen. Er ist mangels Unterbaus beziehungsweise einer operativen Ebene und mangels adäquater Ressourcen praktisch nicht fähig, seine Aufgaben und Kompetenzen aus dem IT-Staatsvertrag wahrzunehmen.
Sieht man in Art. 91c GG mehr als nur eine Kompetenznorm, sondern als Auftrag für den IT-Planungsrat im Sinne einer verbindlichen Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kommunen in der IT und im eGovernment, dann begründet ein solcher Auftrag zur Zusammenarbeit in Verbindung mit der im IT-Grundrecht verfassungsrechtlich verankerten staatlichen Schutzpflicht zur Gewährleistung der Sicherheit und Funktionsfähigkeit informationstechnischer Systeme und der aus Art. 12 GG folgenden Pflicht zur Marktorientierung in Verbindung mit dem Zurückhaltungsgebot aus Wettbewerbs- und Haushaltsrecht auch die Pflicht zur Entwicklung und Veröffentlichung einer marktorientierten IT-Strategie.
(ID:43945598)



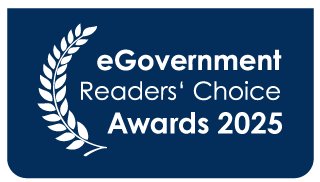
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/af/71/af710f2324ffaaa6e92a94cebb410b4c/0129027955v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/06/56/0656dde5da8186edbcd9b5744e8d79dd/0128976823v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/70/0b/700b87cbe34be72ed07e083a370f457c/0128930206v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/7e/01/7e01f9af699f512a4ee3bbb345c9ddb9/0128945446v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/9e/ef/9eefeefb8678f686f411f815da14b2b6/0128990150v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/10/72/10727eefe17cceada183cd4325a60db9/0128259302v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/0c/ca/0cca515782c0b653d6b1a7a0a2551ec5/0128921072v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/a3/47/a347b6ef39e7fdaf8bf3f17e31914d25/0128604029v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/80/5b/805b612af7de02ab07b2a1a397440f3b/0128166269v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/5f/8f/5f8faad4afec8fe9e707f4dcf66f2241/0128310661v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/26/4e/264eb24d3d8fb6970634864f5caa0c9a/0128145508v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/f7/08/f7086bdbf995dd01a59ee4c05c98c18e/0128147516v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/92/0d/920d464a10fdaabbed2a225131b40428/0128865118v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/bd/bd/bdbd1321376cb252ca316049f04b85ea/0128715415v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/39/97/39975f57a9c6e6de2a5a8b366113e7d0/0128720584v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/4d/e4/4de4451360df23707ec5a930ce162b95/0128444441v6.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/a2/1c/a21c5cbcfc2114968d324ef51f71a997/0128496655v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/55/49/5549944daffc8a848b82db8f3abcee30/0127845342v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/58/61/5861a71de0ab86cd686739c3e4b0d23c/0128079172v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/9a/dd/9adda3170a0349cdecf8355ecb1b5f3d/0124723437v3.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/a5/77/a57764d9ab42cddc9ce74c79f8afbff5/0124379835v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/82/1f/821f31598dfc3f1aca3ead28fcf3529b/0123901076v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/d2/38/d238b9e6c5bec4995cff976c5a00870e/0127069863v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/f4/28/f42807d575943540de71f909fa871105/0125662510v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/71/80/7180526003a0e18ec27f4ea35b590a74/0125015548v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/0a/4a/0a4a09b1d8a5e718a0f9357810b613ee/0125273923v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/11/a4/11a4262cb4795d3c5c4f8b494db16798/0125243090v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/b6/69/b669d70fd07e52da911b10385ef06f11/0122476909v1.jpeg)
:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/67/9c/679c90e925450/materna-square-logo-rgb.jpeg)
:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/68/fb/68fb93af0a60e/logo-square.jpeg)
:fill(fff,0)/images.vogel.de/vogelonline/companyimg/102000/102099/65.jpg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/b5/04/b5044f9ffdb54831d64a5d38f46e7a58/0122824292v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/27/70/2770bb8f6c7c39ca0f5b66fbb1705964/0127931373v1.jpeg)