Anbieter zum Thema
Das Beschaffungsverhalten auf dem Prüfstand
5. Herstellung, Nutzung und Regulierung von IT müssen in jenem Maße erfolgen, dass öffentliche Aufgaben effizient und rechtskonform erledigt werden, der Staat seiner Verantwortung für die Sicherheit und Funktionsfähigkeit der IT-Systeme gerecht wird und zugleich der Notwendigkeit und Verantwortung privatwirtschaftlicher Bereitstellung und Weiterentwicklung von Software und Services Rechnung trägt. Weder darf der Staat das Übermaßverbot durch unnötige Marktbeeinflussung noch das Untermaßverbot durch sorglose Zurückhaltung verletzen.
Digitale Gewaltenteilung bedeutet in diesem Kontext, das Wettbewerbs- und Beschaffungsverhalten sowie die IT-Steuerung der öffentlichen Hand auf den Prüfstand zu stellen. Dies überträgt den Gedanken von „checks and balances“ auf die Machtverteilung bei der IT-Steuerung. In Zeiten globaler Digitalisierung und ihrer Auswirkungen auf Steuerung und Kontrolle („Code is law“) sollte sich Gewaltenteilung nicht auf die staatlichen Gewalten der Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung beschränken. Vielmehr sind die Kompetenzen und Kräfte der Privatwirtschaft einzubeziehen. Das betrifft gleichermaßen Teilhabe als auch Machtbegrenzung bei der IT-Steuerung.
Damit soll auch der problematischen Tendenz entgegenwirkt werden, die sich aus der latent grenzenlosen Organisationshoheit und politischen Gestaltungsmacht des Staates ergibt. Vernachlässigt dieser in Bezug auf IT-Entwicklung und IT-Einsatz die Interessen, Kapazitäten, Kompetenzen und Potentiale der IT-Wirtschaft, entsteht eine kaum überschaubare Gefährdungslage für die Konsistenz und Nachhaltigkeit der IT-Systeme und ihrer Komponenten. So werden oft IT-Lösungen staatlicherseits veranlasst oder realisiert, die am Markt „nicht ankommen“, weil sie die Markentwicklungen missachten, oder unverhältnismäßig hohe Kosten verursachen, weil der Aufwand zur Erstellung spezifischer Lösungen falsch eingeschätzt wird.
Staatliche Organisationen sind oft gar nicht in der Lage, die für das Bestehen am Markt erforderliche Agilität bei der Entwicklung von IT-Systemen zu zeigen. So ist stets zu fragen: Wird die öffentliche Hand ihrer Marktverantwortung gerecht? Befinden sich staatliche Vorgaben und privatwirtschaftliche Entfaltung auf dem IT-Markt in der richtigen Balance? Wenn nicht, kann eine Vorschrift, ein Vorpreschen oder eine Vorteilserlangung der öffentlichen Hand rechtswidrig oder IT-politisch verfehlt sein. Dies lässt sich an verschiedenen Fallgruppen und Praxisbeispielen darlegen.
6. Der Vertrieb einer sog. Behördensoftware (als einer von der öffentlichen Hand entwickelten oder von ihr in Auftrag gegebenen Software, deren Verbreitung in Konkurrenz zu vorhandener Software tritt) bedeutet einen faktischen Grundrechtseingriff in die Berufsfreiheit am Markt agierender Softwarehersteller bzw. IT-Dienstleister. Dieser Grundrechtseingriff bedarf einer gesetzlichen Grundlage, aus der sich Art und Umfang einer etwaigen Marktregulierung demokratisch legitimieren lassen. Im Rahmen der Verhältnismäßigkeit i.e.S. sind die Auswirkungen auf den bestehenden Markt der eGovernment-Fachanwendungen auch unter dem Aspekt der Innovationshemmung und nachhaltiger Aufgabenerfüllung zu untersuchen.
Von der direkten Erstellung einer Software durch Behördenmitarbeiter selbst unterscheidet sich nur geringfügig die Erstellung einer Software aufgrund einer Ausschreibung, die durch enge Vorgaben dafür sorgt, dass Marktprodukte nicht konkurrenzfähig sind. Auch die Ausschreibung einer Weiterentwicklung eines im staatlichen Auftrag entstandenen Prototyps täuscht über die langfristige Kostenentwicklung hinweg und nimmt Herstellern von Standardsoftware die Chance, bei der Beauftragung zum Zuge zu kommen.
(ID:43945598)



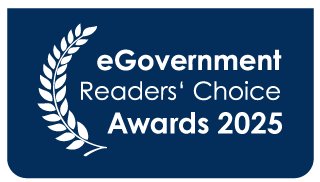
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/af/71/af710f2324ffaaa6e92a94cebb410b4c/0129027955v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/06/56/0656dde5da8186edbcd9b5744e8d79dd/0128976823v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/70/0b/700b87cbe34be72ed07e083a370f457c/0128930206v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/7e/01/7e01f9af699f512a4ee3bbb345c9ddb9/0128945446v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/9e/ef/9eefeefb8678f686f411f815da14b2b6/0128990150v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/10/72/10727eefe17cceada183cd4325a60db9/0128259302v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/0c/ca/0cca515782c0b653d6b1a7a0a2551ec5/0128921072v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/a3/47/a347b6ef39e7fdaf8bf3f17e31914d25/0128604029v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/80/5b/805b612af7de02ab07b2a1a397440f3b/0128166269v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/5f/8f/5f8faad4afec8fe9e707f4dcf66f2241/0128310661v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/26/4e/264eb24d3d8fb6970634864f5caa0c9a/0128145508v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/f7/08/f7086bdbf995dd01a59ee4c05c98c18e/0128147516v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/92/0d/920d464a10fdaabbed2a225131b40428/0128865118v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/bd/bd/bdbd1321376cb252ca316049f04b85ea/0128715415v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/39/97/39975f57a9c6e6de2a5a8b366113e7d0/0128720584v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/4d/e4/4de4451360df23707ec5a930ce162b95/0128444441v6.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/a2/1c/a21c5cbcfc2114968d324ef51f71a997/0128496655v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/55/49/5549944daffc8a848b82db8f3abcee30/0127845342v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/58/61/5861a71de0ab86cd686739c3e4b0d23c/0128079172v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/9a/dd/9adda3170a0349cdecf8355ecb1b5f3d/0124723437v3.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/a5/77/a57764d9ab42cddc9ce74c79f8afbff5/0124379835v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/82/1f/821f31598dfc3f1aca3ead28fcf3529b/0123901076v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/d2/38/d238b9e6c5bec4995cff976c5a00870e/0127069863v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/f4/28/f42807d575943540de71f909fa871105/0125662510v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/71/80/7180526003a0e18ec27f4ea35b590a74/0125015548v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/0a/4a/0a4a09b1d8a5e718a0f9357810b613ee/0125273923v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/11/a4/11a4262cb4795d3c5c4f8b494db16798/0125243090v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/b6/69/b669d70fd07e52da911b10385ef06f11/0122476909v1.jpeg)
:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/67/9c/679c90e925450/materna-square-logo-rgb.jpeg)
:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/68/fb/68fb93af0a60e/logo-square.jpeg)
:fill(fff,0)/images.vogel.de/vogelonline/companyimg/102000/102099/65.jpg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/b5/04/b5044f9ffdb54831d64a5d38f46e7a58/0122824292v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/27/70/2770bb8f6c7c39ca0f5b66fbb1705964/0127931373v1.jpeg)