Anbieter zum Thema
Neue Technologien, zum Beispiel Blockchain, machen völlig neue Verwaltungsprozesse möglich, die im Extremfall sogar ohne Verwaltung auskommen. Welcher Wandel steht im Zeichen der Digitalisierung den öffentlichen Verwaltungen bevor?
Parycek: Für die Verwaltung ist dieser Wandel eine gewaltige Herausforderung. Das hat auch mit neuen Technologien zu tun, aber noch mehr mit den Prozessen, die sich verändern. Hier steckt meiner Ansicht nach auch noch sehr viel Potenzial für die radikale Vereinfachung und Automatisierung von Verwaltung. Nehmen Sie das Beispiel der Antraglosen Familienbeihilfe aus meiner Heimat Österreich. Hier wurde eine Verwaltungsleistung komplett automatisiert, indem die entscheidenden Informationen zusammengeführt wurden, der Antrag fingiert wird und im Fall des Vorhandenseins aller notwendigen Voraussetzungen vollautomatisiert entschieden wird und das Kindergeld den Eltern auf ihr Bankkonto überwiesen wird.
Der digitale Wandel ist also zu einem ganz großen Anteil ein Wandel der Prozesse, der Arbeitsabläufe. Das heißt im Detail natürlich auch Anpassung der Gesetzgebung und ein Kulturwandel in den Behörden als dauerhafter Prozess. An einen völligen Verzicht auf Verwaltung glaube ich nicht, auch wenn wir gerade einen ziemlichen Hype um die Blockchain haben.
Im Fall der Blockchain fallen zwar in der Transaktion die Intermediäre weg, es braucht aber weiterhin vertrauenswürdige Organisationen, die den Nachweis beispielsweise der Staatsbürgerschaft, der Geburt oder des Todes in einer Blockchain erbringen – und genau dazu ist eine funktionierende staatliche Verwaltung prädestiniert.
Ähnliches gilt vielleicht auch für das Erfolgsmodell Föderalismus. Was bedeutet es, wenn staatliche Dienstleistungen zentral vorgehalten werden?
Parycek: Natürlich hat die Digitalisierung auf den Föderalismus Einfluss, allerdings ohne ihn grundsätzlich in Frage zu stellen. In einer zunehmend komplexen Welt bringen gerade dezentrale Systeme Stabilität in ein volatiles digitales System. Aber in Bezug auf Verwaltungsverfahren im engeren Sinn sollten örtliche und sachliche Zuständigkeiten, die in einer analogen nicht vernetzten Welt entwickelt wurden, kritisch hinterfragt werden dürfen.
Beispielsweise wurde die Zuständigkeit für die ehemaligen „Kreisgerichte“ in Österreich mit der Vorgabe einer nicht längeren Anreise eines Tages via Ochsenkutsche „gezogen“. Verwaltungsdienstleistungen, die voll- beziehungsweise teilautomatisiert durchgeführt werden können, brauchen nicht x-fach entwickelt werden.
Noch dramatischer ist die Situation im Bereich der Stammdaten. Der Bürger muss im Fall des Umzugs der jeweils zuständigen Behörde mit schriftlichen Nachweisen beweisen, dass er existiert – dies ist anachronistisch.
Es braucht daher gemeinsame Basisdienste und vernetzte Register als Grundlage für eine papierlose digitale, voll- beziehungsweise teilautomatisierte deutsche Verwaltung. Das Verhältnis der Kompetenzen zwischen Bund, Ländern und Kommunen im Föderalismus ist daher nicht starr, sondern ist nach pragmatischen Gesichtspunkten immer wieder neu auf Basis der Technologien auszuverhandeln.
(ID:44895661)



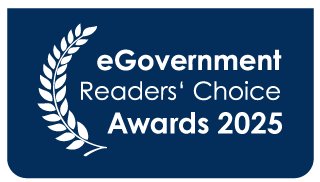
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/2f/3b/2f3b8786c5f08f24411805165ad83718/0129164624v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/59/20/59205bd98654a24dfa2d570575bf9a5c/0129092644v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ab/8b/ab8bc181d73780160b3ec5cd42d07fa0/0129185631v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/be/f6/bef62e597e41e9b5beedb4a479b98472/0129096954v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/96/f9/96f97508883e030cac8f2a3827040b3d/0129108367v3.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/49/be/49bece5be9ab23d2562a68946cbf2829/0129124933v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/b6/fc/b6fc1d32194466a5b67548c19c2f76f5/0129131184v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/a8/c9/a8c959f32cc4ebba6cf1531d77785a4b/0129094039v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/80/5b/805b612af7de02ab07b2a1a397440f3b/0128166269v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/5f/8f/5f8faad4afec8fe9e707f4dcf66f2241/0128310661v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/26/4e/264eb24d3d8fb6970634864f5caa0c9a/0128145508v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/71/ae/71aeab856e1def738378eb2203cf1a03/0129192734v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/e3/df/e3df2d6cab8d3fea553fa397b6d73d8a/0129271243v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/a1/79/a179b1f60693c8e886d152a33f88c7ab/0129235934v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/d4/9e/d49eec271624b4eed3e4b8ba1d4a6f4b/0129251516v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/a4/ed/a4edd26c3f9be221cda55c459182f3e2/0129236742v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/18/96/1896e3a6ff5662cb8cc3916e70eaaca1/0128771682v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/4d/e4/4de4451360df23707ec5a930ce162b95/0128444441v6.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/a2/1c/a21c5cbcfc2114968d324ef51f71a997/0128496655v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/9a/dd/9adda3170a0349cdecf8355ecb1b5f3d/0124723437v3.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/a5/77/a57764d9ab42cddc9ce74c79f8afbff5/0124379835v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/82/1f/821f31598dfc3f1aca3ead28fcf3529b/0123901076v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/d2/38/d238b9e6c5bec4995cff976c5a00870e/0127069863v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/f4/28/f42807d575943540de71f909fa871105/0125662510v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/71/80/7180526003a0e18ec27f4ea35b590a74/0125015548v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/0a/4a/0a4a09b1d8a5e718a0f9357810b613ee/0125273923v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/11/a4/11a4262cb4795d3c5c4f8b494db16798/0125243090v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/b6/69/b669d70fd07e52da911b10385ef06f11/0122476909v1.jpeg)
:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/62/8c/628cba8e3f912/logo-governikus-600px.png)
:fill(fff,0)/images.vogel.de/vogelonline/companyimg/102000/102099/65.jpg)
:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/64/92/6492d97a1172a/mgmlogo.png)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/7b/f8/7bf801839f1191a9f1f9334f0b051343/0124895859v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/80/5b/805b612af7de02ab07b2a1a397440f3b/0128166269v2.jpeg)